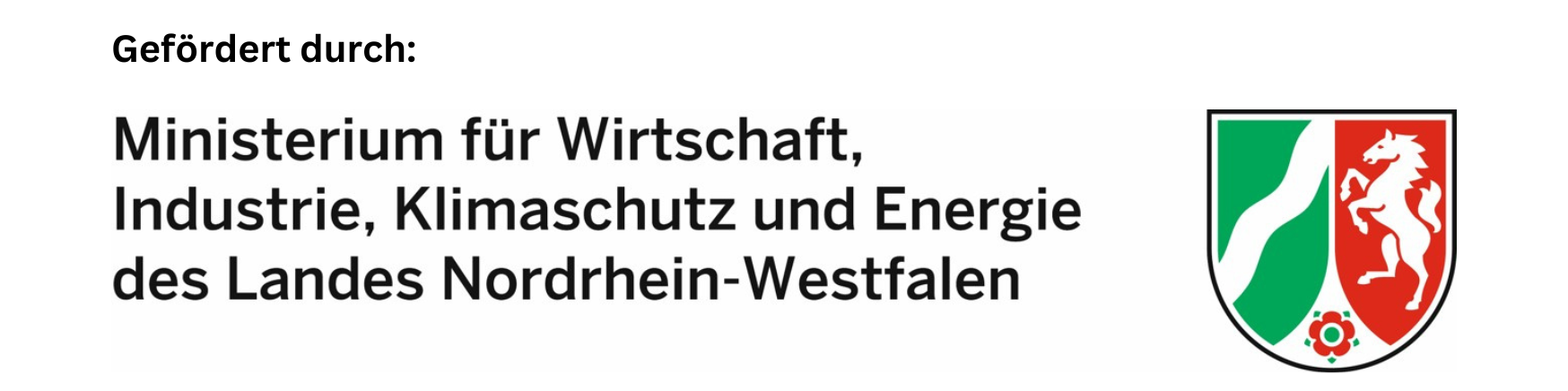Am 2. September waren rund 70 Entscheiderinnen und Entscheider der maritimen Logistik der Einladung des vom Log-IT Club und Verband Verkehrswirtschaft und Logistik NRW (VVWL) getragenen Kompetenznetzes Logistik.NRW gefolgt, um in den Räumlichkeiten der Industrie- und Handelskammer Duisburg-Wesel-Kleve zu Duisburg über die neuesten Entwicklungen zu diskutieren.
Dr. Christoph Kösters, Manager des Kompetenznetzes.NRW und Hauptgeschäftsführer des VVWL betonte, dass Schifffahrt und Häfen wichtiger Teil der nordrhein-westfälischen DNA seien. Natürlich sei der Rhein dabei von besonderer Bedeutung. Der Industrie- und Logistikstandort Nordrhein-Westfalen insgesamt benötige aber immer zwei Ver- und Entsorgungskorridore, einmal über die West-Seehäfen und auch über die Nord-Seehäfen. Daher müssten sich Wirtschaft und Logistik auch auf das Kanalnetz verlassen können. Das Sondervermögen – also mehr Geld für die Infrastruktur bereitzustellen – sei eine gute Idee. Wir alle wissen, der Nachholbedarf bei Straße, Schiene und Wasserwegen ist gewaltig. Es dürfe aber nicht sein, dass das Sondervermögen dafür genutzt wird, um Haushaltspositionen in großem Umfang hierhin zu verschieben. Das vorher beschlossenen Prinzip der Zusätzlichkeit wackele sehr, so z.B. auch in der Vereinbarung des Bundes hierzu mit den Ländern. Und auch erste Länder gehen bei diesen avisierten Mitteln in diese Richtung. Das habe man auch dem NRW-Ministerpräsidenten Hendrik Wüst in einem gemeinsamen Verbändeschreiben (Bau, Chemie, Handwerk, VVWL) Ende Juli so mitgeteilt. Für die Wasserstraßen müsse der Bund eine auskömmliche und überjährige Finanzierung für Betrieb, Unterhalt, Ersatz und Ausbau der Bundeswasserstraßen in Höhe von mindestens 2,5 Mrd. Euro jährlich sicherstellen.
Auch der Präsident der niederrheinischen IHK zu Duisburg Werner Schaurte-Küppers als Gastgeber in der Begrüßungsrunde mahnte eine zusätzliche Verwendung dringend an. Schaurte-Küppers bemängelte zudem, dass in den Sonderschulden des Bundes die Wasserstraße nicht aufgeführt sei. „Schifffahrt und Häfen sind für NRW Motor für die Wirtschaft. Wir sind das Wasserstraßen- und Hafenland Nr. 1 in Deutschland. Der Rhein und die schnelle Verbindung zu den Seehäfen sind ein echtes Alleinstellungsmerkmal Stahl und Chemiebetriebe hätten sich hier angesiedelt, weil der Rhein so viel Kapazität hat und weil er so zuverlässig ist. Deshalb gelte auch: Kaputte Spundwände, fehlende Hafenflächen oder Niedrigwasser sind Standortfragen und nicht lästige Randthemen. Sie beträfen die ganze Logistikkette und entscheiden über Investitionen und die Zukunft der Industrie“, so Werner Schaurte-Küppers.
Philip Sassenrath, MdB CDU und Vorsitzender der Parlamentarischen Gruppe Binnenschifffahrt und Binnenhäfen, gab als Mitglied des Verkehrsausschusses im Deutschen Bundestag einen tieferen Einblick in die Politik. Als Neusser sei es für ihn wichtig, die 90 Kilometer Rheinschiene in Bezug auf die Häfen als zusammenhängende Wertschöpfungskette zu denken. In diesem Geschäftsmodell „Rheinland“ seien drei Säulen derzeit in Gefahr: Im Umfeld energieintensiver Industrieunternehmen sei in der Transformation ein adäquater Ersatz für auslaufende fossile Energieressourcen noch nicht geschaffen worden. Darüber hinaus würde im Herzen Europas mit guter Anbindung an die Westhäfen ausgerechnet die marode Infrastruktur ein Wachstum beschränken. Die bisherigen Ergebnisse der Haushaltspolitik des Bundes könnten – insbesondere im Hinblick auf die Wasserstraßen – nicht zufrieden stimmen, auch wenn die kurze Zeit zur Finalisierung des Haushaltsplanes kaum ausreichend sein konnte. Der Lackmustest werde der Haushalt 2027 sein, der in einem Jahr erstellt sein müsse. Verschiebeeffekte beim Sondervermögen seien für ihn – auch als Vertreter der jüngeren Generation – unbefriedigend, weswegen in der laufenden Diskussion eine deutliche Priorisierung auf die eigentlichen Verwendungsbereiche gefordert würde. Der Wirtschaftsstandort NRW zeichnete sich – auch heute - stets durch eine besonders hohe Qualität und gute Verfügbarkeit an Fachkräften aus. Hier sei eine dritte Säule als Herausforderung zu meistern, um angesichts Demografie und sonstiger Mega-Trends dies auch in Zukunft als Wettbewerbsvorteil zu gewährleisten.
Zur Forderung nach Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren verwies Philip Sassenrath auf die schon geschaffenen Möglichkeiten. Die Möglichkeiten schneller Ersatzbauten für bestehende Infrastruktur seien politisch als Ermessensspielräume bereits geschaffen worden. Diese gelte es jetzt zu nutzen.
Die Sicht der verladenden Wirtschaft erläuterte in einer weiteren Keynote Johannes Pöttering von unternehmer.nrw. Selbst am Arbeitsmarkt sei inzwischen ein Kipppunkt in der wirtschaftlichen Entwicklung zu bemerken, da mittlerweile einige Unternehmen die Strategie aufgeben würden, aufgrund des demografischen Wandels trotz fehlender Auslastung an Personal festzuhalten. Im Vergleich zum Jahr 2018 habe die Industrieproduktion um 20 % nachgegeben, die Beschäftigungszahlen sanken im gleichen Zeitraum „nur“ um 7-8 %. Gleichzeitig werde in der Metall- und Elektroindustrie von Tarifbeschäftigten durchschnittlich 65.000 € an Jahreseinkommen verdient. Die Nähe von einander abhängiger Industrien in NRW sei dabei nicht nur ein logistischer Vorteil. Die geschlossenen Wertschöpfungsketten von Chemie, Aluminium, Stahl und Energie seien ein enormer Standortvorteil. In der Vergangenheit war der Export das wichtigste Standbein unserer Wirtschaft, die neuen geopolitischen Bedingungen würden dies jedoch belasten. Allerdings seien nicht nur Zölle Teil des Problems: Steuern, Löhne, Energiekosten würden zum kontinuierlichen Sinkflug beitragen. Die derzeitigen Debatten rund um Pflege und Rente seien natürlich nicht einfach und würden den Haushalt belasten. Hätte NRW jedoch ein normales Wachstum von zwei Prozent in den letzten Jahren erwirtschaften können, stünden zehn Milliarden Euro mehr an Haushaltsmitteln im Land zur Verfügung – im Bund sogar 100 Milliarden. Um die Wirtschaft wieder anzukurbeln, sei eine verlässliche Grundbedingung der Wiederaufbau der Infrastruktur. Konsumtive Ausgaben aus den Mitteln der Infrastruktur zu bedienen verböte sich daher aus Sicht der Wirtschaft. Hinsichtlich der Arbeitsteiligkeit betonte Pöttering, dass zwar Abhängigkeiten von einzelnen Lieferanten und Herkunftsländern vermeiden werden müssten, es sei jedoch allein aus Kostengründen illusorisch, eine Unabhängigkeit von China anzustreben.
Gemeinsam mit Bettina Brennenstuhl, Vorstand Dortmunder Hafen AG und Markus Krämer, CEO HGK diskutierten Philipp Sassenrath und Johannes Pöttering unter der Moderation von DVZ-Chefredakteur Sebastian Reimann die Perspektiven und Herausforderungen für die maritime Logistik. Brennenstuhl betonte, dass der Dortmunder Hafen sich strukturell zum Universalhafen gewandelt habe. Um die Transformation weiter voran zu bringen, benötige der Hafen jedoch weiterhin Flächen auch zum Umschlag von Windenergieanlagen. Diese dürften nicht anderen Stadtentwicklungsmaßnahmen geopfert werden. Markus Krämer pflichtete bei, dass Transformation in den letzten Jahren zum Tagesgeschäft gehörten und ehemalige Erz- oder Kohlehalden heute anders genutzt würden. Pöttering merkte an, dass gerade in NRW eine Konkurrenz um freie Flächen entstanden sei, was für annähernd alle Branchen gelte. Gerade der Übergang auf alternative Energietechniken vergrößere den Bedarf für zusätzliche Flächen, da zuerst die Alternative fertiggestellt sein müsse, bevor die herkömmliche Technik außer Betrieb genommen werden könnte. Philip Sassenrath machte deutlich, dass die langatmig anmutenden Diskussionen um den Bundeshaushalt ihre Daseinsberechtigung hätten; so seien große Anteile des Haushaltes klar gesetzt, um die verbleibenden Mittel entstünde eine Verwendungskonkurrenz. Wichtig sei es jetzt Industrieland zu bleiben, um künftig klimaneutrales Industrieland zu werden. Johannes Pöttering betonte, dass auch im europäischen Vergleich die Energiekosten in Deutschland zu hoch seien. Planungssicherheiten müssten über Legislaturperioden hinweg gewährleitet sein. Bettina Brennenstuhl betonte, dass ein aufgestellter und vom Rat abgesegneter Hafenentwicklungsplan in der nächsten Wahlperiode schon Makulatur sein könnte. Flächensicherheit sie für die langfristige Entwicklung unabdingbar. Markus Krämer verdeutlichte, dass auch die Planungssicherheit der Kundschaft fokussiert werden müsse. So sei das Ausflaggen von zwei größeren Chemieproduzenten im Kölner Westen auch nachteilig für die regionale Wirtschaft, natürlich auch für die Logistik.
Die zweite Sequenz eröffnete Friedrich Stuhrmann, CCO Hamburg Port Authority mit einem Statement zur Energiewende. Gerade bei fossilen Brennstoffen, die immer noch über drei Viertel des Energiebedarfes decken würden, seien die Energieimporte hoch: 99 % der Mineralöle, 96 % fossiler Gase und 47 % Kohle kämen aus dem Ausland und würden insbesondere über die Seehäfen umgeschlagen. Doch gerade die energetische Transformation stelle eine Chance für den Hamburger Hafen dar, da ein Großteil des benötigten Wasserstoffs ebenfalls importiert würde. Auch angedachte Carbon-Capture-Verfahren würden über die Seehäfen realisiert werden. Die Dekarbonisierungsstrategie der HPA würde alle Verkehrsträger einbeziehen: Rangierverkehre mit alternativem Antrieb auf der Schiene, E-Ladeinfrastruktur und Wasserstofftankstelle für die Straße und Landstrompflicht für Kreuzfahrt- und Containerschiffe ab 2030 würden durch eine eigene Stromerzeugung durch Windkraft und Photovoltaik abgerundet.
In der zweiten Podiumsrunde diskutierten Eva Lingrün, Gruppenleiterin 72 im Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie des Landes NRW, Andreas Stöckli, Vorstand Rhenus SE, Richard Schroeter, Port Representative & Business Development Hydrogen/CCUS Häfen Antwerpen und Brügge, und Andreas Stahl, Managing Director SBRS GmbH (Shell Business Recharge Solutions) gemeinsam mit Friedrich Stuhrmann. Eva Lingrün unterstrich, dass NRW einen hohen Wasserstoffbedarf haben wird. Wichtig sei es, für grüne Produkte einen Markt zu schaffen. Richard Schroeter betonte, dass in Antwerpen/Brügge bereits Anlagen zur Lagerung und zum Cracking von Ammoniak errichtet und Raffinerien zurückgebaut würden. Der heutige Status als größtes europäisches Chemie-Cluster sei hier hilfreich. Andreas Stöckli betonte, dass auf dem Weg zur Transformation auch kostspielige Wege ausprobiert werden müssten, die sich als Sackgasse erweisen würden. Letztendlich müsste Dekarbonisierung rentabel bleiben, gerade Wasserstoff sei eine sehr teure Lösung. Stahl erläuterte, dass sich Shell vom Mineralölkonzern zum Energielieferanten gewandelt habe. Für die Logistik sei künftig die Zusammenarbeit bei der Transformation von Bedeutung. So böte die SBRS Lösungen für geteilte hybride Ladenetze an, die eine Erschließung durch das Stromnetz überhaupt erst möglich machten. Andreas Stöckli schilderte seinen Eindruck, dass Genehmigungsverfahren in der Schweiz eher pragmatisch angegangen würden, während es in Deutschland allen recht gemacht werden müsse. Eva Lingrün entgegnete, dass in Verfahren oft weniger echte strukturelle Probleme vorliegen würden, vielmehr würden die Genehmigungsbehörden häufig sehr spät eingeschaltet werden. Ihre Erfahrung: Je früher in einem Projekt bzw. Verfahren die Kommunikation mit den zuständigen Behörden gesucht würde, desto leichter wäre es, den Ermessensspielraum zu erläutern und zu nutzen.